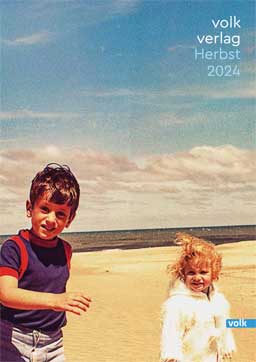Bayerische Geschichten 4/2024: 77 musikalische Schmähgedichte von Andreas Martin Hofmeir
Liebe Leserinnen und Leser,
2024 ist das Jahr der Tuba. „Die einzig mögliche Wahl“ für Andreas Martin Hofmeir, Tuba-Spieler und als solcher einer der besten und vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart. Dazu ist Hofmeir ein Grenzgänger zwischen den Genres: Professor am Mozarteum Salzburg, Gründungsmitglied der bayerischen Kultband LaBrassBanda, als Kammermusiker ebenso erfolgreich wie als Kabarettist – und als Autor! Sein neuestes, von Carl-H1 Daxl illustriertes Werk vereint spitzbübische Kabarett-Lyrik mit der genuin bayerischen Kunst des Derbleckens: 77 Schmähgedichte, auf Hochdeutsch und Starckdeutsch, führen durch die Welt der Instrumente und nehmen jedes einzelne davon aufs Korn. Denn das hundsgemeine Instrumentenvolk kennt nur eine Königin: die Tuba!Das Zuckerl zum Buch kann sich auch sehen, oder besser, hören lassen: Sämtliche Gedichte wurden vom Autor höchstpersönlich eingesprochen, die Audio-Dateien sind per QR-Code abrufbar. Eine Wucht! Besonders, wenn Hofmeir die starckdeutschen Texte kraftvoll intoniert.

Die Gitarre
Wer kennt es nicht: Man sitzt im Kreis
ums Lagerfeuer – vorne heiß,
von hinten kalt, das Bier schmeckt fein,
der Himmel könnt‘ nicht schöner sein,
die Scheite knistern, manche tuscheln,
Pärchen fangen an zu kuscheln,
das Idyll ist kitschig schon –
doch plötzlich hört man einen Ton
aus aufgespanntem Schweinsgedärm.
Man ahnt, man weiß, gleich kommt der Lärm,
den man so fürchtet an der Stell
– ihr habt es auch erlebt schon, gell?
Dass plötzlich in des nächtens Ruh‘
ein Motivierter kommt dazu,
bewaffnet mit dem Heft „Querbeet“,
wo Fürchterliches drinnen steht,
versucht nun, mit den drei Akkorden,
die er kann, akustisch z‘morden,
und wenn‘s hart kommt mit dem Laster
seiner Zunft: dem Kapodaster.
Starr blickt man ins brennend‘ Scheit
und grübelt: Wieso kommt‘s so weit,
dass jeder Trottel heutzutag‘
Gitarre dilettieren mag.

Das Starckdeutsche
Was im ersten Moment wie eine zusammengewürfelte Aneinanderreihung von Buchstaben wirken mag, ist in Wahrheit die Kunstsprache Starckdeutsch. 1972 wurde sie vom deutschen Maler und Dichter Matthias Koeppel erfunden, der sie selbst fürs Verfassen parodistischer Lyrik verwendete. Ein Regelwerk sucht man hier umsonst, doch gibt es gewisse Merkmale, die das Starckdeutsche kennzeichnen: Verstärkung und Verhärtung der gehäuft zum Einsatz kommenden Konsonanten (ckck, ff, nnn), übermäßige Nutzung von Diphthongen (ei, ou, ui) oder Dehnung und Verdunklung der Vokale. In der Satzkonstruktion kommt es nicht selten zur mehrfachen Verneinung („Bei uns hat no nia net koana koa Bier net woin“) – vor allem Bairischkenner sind hier klar im Vorteil. Die volle Wirkung des Starckdeutschen entfaltet sich nicht bei der stillen Lektüre, sondern im laut(malerisch)starken Vortrag.

Das Englischhorn
Ön Auraroppa keippts eun Lunt,
tass forr Varruckthoiten peikunnt:
Mann fuurt durrt auff drr pfulschn Soitt,
schteitt eun dr Schlaung di hullpe Zoitt,
zeiit süch pei uchcht Groot t‘Juckn auß,
frösst Schlömmres uls der Veicher Frouß
ont spöllt a kaumischs hulzerns Hurrn,
diß klönckt garr öngleisch ontt falurrn
wwi eun farrzwuifelt blaukent Schouff.
Keun Önstromunt heit diß ßo drouff.
- ISBN: 978-3-86222-494-4