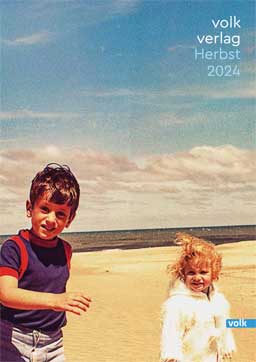Bayerische Geschichte(n), 19/2018: Von Buddha und anderen Heiligen – Huber erzählt aus 12.000 Jahren Weihnachten

Liebe Leserin, lieber Leser,
die religiösen Ideen der Welt waren immer schon miteinander verwoben und kaum etwas hält sich so hartnäckig wie eine Tradition, die den Menschen schlicht hervorragend gefällt, ganz egal mit welchem Glauben sie verknüpft ist. Wer zum Beispiel meint, der Turbokonsum der Adventszeit wäre ein rein moderner Auswuchs, der irrt: Das Schenken, gerne exzessiv, war immer schon ein Ritual, mit dem man das Band der Zuneigung mit Familie und Freunden, sogar mit den Göttern, enger knüpfte. Die Römer brachten alljährlich zum Höhepunkt ihrer Saturnalien-Feiern am 24. Dezember nicht nur diverse Opfer in ihren Tempeln, sondern machten auch ihren Lieben zu Hause eine Freude. Ursprünglich wurden kleines Spielzeug aus Ton, Öllämpchen und Wachskerzen verschenkt. Das wuchs sich aber in Nullkommanichts zu teuren Gewürzen, exotischem Obst, Kleidung, Geschirr, Büchern, Kosmetik oder gleich einem ganzen Spanferkel aus – überreicht mit einer witzigen Widmung. Der Dichter Martial hat so einmal eine Wurst mit dem Vermerk hergeschenkt, die habe er selbst vor einiger Zeit bekommen.

Ihre Saturnaliengeschenke kauften die Römer übrigens auf einem speziellen, nur zur Winterzeit stattfindenden Markt. Ein solcher Weihnachtsmarkt brachte viele Jahrhunderte später den Pfarrer der Nürnberger Sebalduskirche 1616 schier zur Verzweiflung: Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als am Sonntag vor dem Heiligen Abend die Predigt ausfallen zu lassen, „weil wegen des Einkaufens zum Kindleinbeschern keine Leut vorhanden gewest“. Ob die Leute damals auch schon auf dem Markt kleine Figuren der drei Weisen aus dem Morgenland für ihre Krippen erstanden haben? Die frühesten Darstellungen der drei zeigen sie weder mit Turban noch mit orientalischem Kopftuch, sondern mit phrygischen Mützen. Eine solche Mütze bestand aus dem gegerbten Hodensack eines Stiers, Kraft und Mut des Tiers sollten dabei auf den Träger übergehen. Karriere machte die Kopfbedeckung auf den Häuptern der Dogen von Venedig und der Jakobiner während der Französischen Revolution. Die populärsten Träger phrygischer Mützen sind heute wahrscheinlich die Mainzelmännchen.
Kaum einer verfügt über ein so umfassendes Wissen zu den Ursprüngen all unserer großen Weihnachtstraditionen wie der BR-Journalist und Autor Gerald Huber. In „12000 Jahre Weihnachten“ beweist er, dass dieses Fest, obwohl heute oft bis zur kitschigen Unkenntlichkeit entstellt, immer noch überraschen kann – vorausgesetzt, man will sich verzaubern lassen von den Mythen, Legenden und den uralten historischen Wurzeln, aus denen unsere winterliche Fest- und Feierzeit erwachsen ist. Warum schon die Römer Lichtmess feierten und was Buddha mit dem Christentum verbindet, das verrät das neue Buch von Gerald Huber.
-
ISBN: 978-3-86222-293-3 €28,00