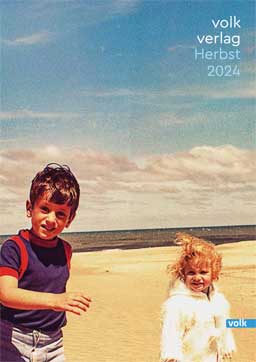Bayerische Geschichten 12/2023: 21 ziemlich wahre Erzählungen
Liebe Leserinnen und Leser,
was macht die Nase zum Kompass der Erinnerung? Wem rettete ein Geschenk von Papst Pius das Leben? Wer war die dicke Hedwig und welcher Herr in Badehose wusste schon 1988, dass die Mauer fällt? Axel Lawaczeck hat darauf die besten Antworten: 21 fein gestrickte, überraschende, doppelbödige Kurzgeschichten – versammelt in „Das Leben zwischen den Stürmen. Ziemlich wahre Erzählungen“. Der Untertitel ist Programm, denn der vielfach ausgezeichnete Autor hat jedem seiner Texte eine Anekdote, Erinnerung oder die eigene Familiengeschichte als wahren Kern mitgegeben.
Leseprobe:
BRAUCHST NICH SCHWITZEN
Neulich hatte ich eine Frau über Nacht da. Am nächsten Morgen hat sie Kaffee für uns gekocht, nett von ihr. Aus Versehen ist ihr dabei mein goldener Becher heruntergefallen und zersprungen. Ich bin wütend. „Warum fasst du den Becher überhaupt an? Der stand doch ganz hinten im Regal!“ „Spinnst du? Ist doch nur ein Becher!“ „Ach, Scheiße“, sage ich und fange an zu flennen.
1995 ist alles noch ostig in Lichtenberg. Verbretterte Geschäfte, alle Nuancen von Grau, seltsame Menschen. Vor dem Haus, in dem ich eine Wohnung besichtigen will, rempelt mich ein Skinhead an. Idiot, pass doch auf, sage ich. Er dreht sich zu mir um, auf seinem Shirt lese ich Keiner macht mehr Ärger als der Lichtenberger. Is was, Arschloch, fragt er mich, Lust uff Schmerzen? Nee, lass mal, murmele ich.
Jetzt also Frankfurter Allee, die ehemalige Stasi-Zentrale nur einen Steinwurf entfernt, das Personal von früher scheint in den umliegenden Blöcken zu leben. Doch die Wohnung ist günstig. Ich frage den Verkäufer, ob er jemanden kennt, der das Bad fliest und solche Sachen. Der Verkäufer sagt, er schickt mir Walter, den alle Pepe nennen.
Am nächsten Wochenende steht er vor meiner Tür, groß, kantig, im Blaumann mit Werkzeuggürtel, unter einem grauen Haarschopf wache Augen. Tach, ick bin Pepe, der Kiezhandwerker. Freut mich, sage ich. Pepe schaut auf mein Klingelschild und dann wieder auf mich. Sind wa nen Dokter? Ja, sage ich, aber kein Arzt. Ingenieur. Wessi, wa? Ich nicke. Und, keene Frau? Nein, die ist weg, deshalb bin ich ja umgezogen. Na dann.
Ich biete ihm erst mal Zigarette und Kaffee an. Wir verstehen uns auf Anhieb und stemmen später gemeinsam die Fliesen von Wand und Boden. Ich erfahre, dass Pepe hier im Kiez geboren wurde. Hat mit zwei Ausnahmen immer hier gelebt. Die Eltern früh getrennt, mit 17 hat er Ärger bekommen: „Mann, wat hab ick früher Scheiße im Schädel jehabt. Nur jesoffen und jeprügelt. Hab einem lang und schmutzig auf die Fresse jehaun, der war meiner Freundin doof jekommen, ick ihm immer mittenmang ins Backpfeifenjesicht, bisser jeglüht hat wie nen Backbordlicht vom Panzerkreuzer. Dabei war der in der Stasi, wusst ick ja nich. Dafür jabs Berlinverbot und ab nach Karl-Marx-Stadt zum Rabotten inne Textilfabrik. Sollte ne Strafe sein, aber waren nur Weiber um mich rum, und ick der einzije Kerl da. Dokter, wat hab ick jevögelt, jeden Tach ne andere, wie Dynamitfischen. Schöne Zeit.“
Später, als Pepe die Ausgleichsmasse gießt: „Dann NVA, ick in Thüringen anner Grenze. Hab mitn paar Kameraden im Suff nen Auto klar jemacht, um durchn Zaun zu brettern. War nich so schlau jewesen. Einjebuchtet hamse mir, drei Jahre, keen Zuckerschlecken, Dokter, bis dein Westen mir freijekooft hat. Dann zwee Jahre in München, aber da im Westen, nich übel nehmen, Dokter, allet Arschgeigen. Als die Mauer fiel, bin ick sofort wieder rüber nach hier. Jab nen Knall durch den Unterdruck, so schnell.“
Pepe lässt die Zeit verfliegen, dazwischen immer Kaffee und Kippen.
Am nächsten Sonntag geht es weiter auf meiner Baustelle, abends sagt Pepe zu mir: „Dokter, kennst doch hier keenen, komm mit ins Galaxy.“
„Was ist das?“
„Na, die Kneipe um die Ecke.“
„Ich dachte, das ist ein Café.“
„Mal so, mal so. Hat rund um die Uhr auf. Meine Frau arbeitet da. Jibt lecker Essen. Bist so dünne, Dokter.“
Also gehen wir ins Galaxy. Von außen ein neongrünes Schaufenster mit toten Topfpflanzen, innen der angelaufene Charme der späten DDR. Gepresstes Spanmobiliar und Sprelacart, Barhocker mit Geflecht, erdbraune Fliesen, in einer Ecke funkeln Spielautomaten, daneben eine Dart-Scheibe, im rückwärtigen Raum ein Billardtisch. Auf dem Tresen Salzstangengläser auf lachsfarbenen Servietten. Davor zwei Handvoll Männer in den Ensembles ihrer Mollen und Schnäpse, Kippendunst färbt alles graublau, die Scheiben schwitzen.
Als Pepe den Raum betritt, gibt es ein großes Hallo.
Pepe nutzt den Moment und stellt mich vor: „Haltet ma die Schnauze. Dit is der Dokter. Kommt jetzt öfta. Is aber keen Arzt, und euch kann sowieso keener helfen.“
Was Pepe sagt, hat Gewicht. Freundliches Nicken am Tresen.
Pepe begrüßt die Bedienung mit einem Kuss und macht uns bekannt: „Dokter, meine Frau – nennen alle Wildschwein, weilse das so lecker kocht.“
Er grinst und schlägt mir auf die Schultern. Ihm wird ein goldener Becher gereicht, auf dem sein Name steht. Darin Kaffee, ich bekomme ein Bier.
„Kein Bier, Pepe?“
„Nee, Alkohol lass ick. Hat mir nur Unglück jebracht. Außerdem, habs am Magen.“
„Dann ist Kaffee aber auch nicht gut.“
„Allet jut, brauchst nich schwitzen, Dokter, ick komm schon klar.“
Als Pepe später aufs Klo verschwindet, sage ich zu Wildschwein: „Pepe ist oft hier, oder? Hat ja sogar seine eigene Tasse.“
Sie nickt: „Haben die Jungs ihm geschenkt. Wegen der Sache mit dem Bauleiter.“
„Was war da?“
„Ist eine Weile her. Pepe ist Betonbauer, hat auf den Baustellen am Potsdamer Platz gearbeitet. Im tiefsten Januar hat ihm mal ein Bauleiter befohlen, Beton auszubringen. Da hat Pepe gesagt, nö, macht er nicht, ist Schwachsinn, friert doch sofort kaputt. Darauf der Bauleiter: Sie machen, was ich sage. Und Pepe ganz liebenswürdig: Einverstanden, aber würden Sie sich bitte kurz umdrehen? Der dreht sich um, und Pepe tritt ihm voll in den Arsch. Den Job war er los, aber die Jungs hier haben das gefeiert.“
Wir sind oft im Galaxy. Montags, wenn es drei Kurze zum Preis von zweien gibt. Dienstags, wenn ein großer Futschi nur zweifünfzig kostet. Wenn die Eisbären spielen. Sowieso am Wochenende. Manchmal gibt es AC/DC-Abende mit Eisbein. Bald lerne ich die Menschen kennen, denen das Galaxy ihre zweite oder erste Heimat ist.
Krause, auch Lumpenpuppe genannt, immer mit drei Promille im Turm. Pepe hat ihn einmal mit zum Arbeitseinsatz genommen, eine Kneipe entrümpeln. Lumpenpuppe hat aus allen Flaschen, die noch da waren, die Reste gesoffen. War noch vor dem Frühstück so angeballert, dass er auf dem Klo einschlief.
Muni, abgeleitet von Munition, der nur von seiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee erzählt. Sein Terrier Gismo kaut immer am Holz der Barhocker. Er macht das schon so lange, dass neulich ein Hocker unter einem Zecher zusammengebrochen ist. Auf Gismos Halsband steht, liebevoll gestickt, die Wahrheit: Ich darf alles.
Joschi, der an der großen Druschba-Trasse mitarbeitete, von Krementschug am Dnepr bis zur Westukraine. Er sagt nie etwas, er trinkt nur.
BFC-Andi, Dynamo-Fan. Schon immer gewesen, seit sein Papa mit ihm ins Jahnstadion zu den Mannen um Trümpler, Kochale und Geserich ging. Im Sommer malocht BFC-Andi als Bauarbeiter in Schweden, sonst sitzt er im Galaxy am Tresen mit Blick auf den Sportkanal.
Neben BFC-Andi hockt Spion, der nach der Wende versuchte, den Bewohnern der Plattenbauten von Hellersdorf Türspione zu verkaufen. Weil es die im Osten noch nicht gab, war er mit Bohrmaschine in den Häusern unterwegs, klingelte und behauptete, er käme von der Hausverwaltung. Er solle die Löcher bohren für die Glaszylinder, die am nächsten Tag ein Kollege einsetzen würde. So hat er Dutzende Wohnungstüren gelocht und pro Tür 50 Mark Vorkasse genommen, bis einer der Bewohner misstrauisch geworden ist. Spion saß dafür ein. Auch weil vorher schon mal was anderes gewesen war.
Am Spielautomaten drückt Ingo blinkende Zahlen hoch. Ein Muskelgebirge, Metalhead, mit langem Zopf, deshalb von allen Inge genannt, Spezialität Trockenbau.
Fliesenmicha ist auch oft da. Mit dem kann Pepe aber nicht viel anfangen, weil der seiner Meinung nach nur Pfusch abliefert.
Überlebenskämpfer, alle. Sitzen hier und das Bier hält sie aufrecht, zusammen mit der Hoffnung, dass jemand ins Galaxy kommt, weil er einen Tagelöhner braucht.
Manchmal ist Pepe traurig, weil er zu seiner Tochter aus einer früheren Beziehung kaum Kontakt hat. Sie ist mit einem Spielsüchtigen ans Ende Berlins in ein Schulzendorfer Reihenhaus gezogen, wo sie den ganzen Tag Fantasy-Rollenspiele am Computer zockt. Ein paar Mal fahre ich Pepe dorthin, weil er keinen Führerschein mehr hat. Ich gehe spazieren, während er bei seiner Tochter ist. Sie trinken Kaffee, während sie weiter mit starrem Blick durch ihre digitale Traumwelt hastet.
Eines Tages ruft Pepe mich an und fragt: „Dokter, kannste mir fahren?“
„Wieder nach Schulzendorf?“
„Nee, nach Nauen. Hab mir über Annonce nen Köter jekooft.“
Der Nauener Hund ist ein kompakter Mischling mit Narben und ausgeprägtem Gebiss, der sich laut Verkäuferin mit anderen Hunden nicht so gut verstehen soll, zu Menschen aber nett ist. Ein Kampfhund also. Er läuft auf Pepe zu und legt sich vor seine Füße. Als die Verkäuferin kurz entschwindet, befördert Pepe gerührt einen Charlottenburger ins Beet.
Wir nehmen den Hund mit. Als wir nach Berlin reinfahren, winselt er unentwegt. Pepe tröstet ihn mit Hundesnacks und erzählt von seinem früheren Hund: „Damals hab ick in Pankow in den Puffs rund um den Majakowskiring jearbeitet, Hausmeistersachen. Hatte immer jute Karten bei die Nutten, bin ja Frauentyp, Dokter. Zahlen musste ich nie. Und wat ham die mein Köter verwöhnt, jab immer wat zu fressen für ihn, son seidiges Fell!“
Im Vorbeifahren zeigt Pepe dem Hund, den er Francis nennt, Alexanderplatz und Fernsehturm. Kurz vor dem Ring-Center bekommt der Hund hinten auf meiner Rückbank die große Scheißerei. „Siehste, Dokter, zu viel Stress. Isn Sensibler, wie ich.“
Als ich im Herbst mal vom Schornsteinfeger wissen will, ob in meinem uralten, zigmal umgebauten Haus noch ein Zug frei ist für einen Ofen, den ich gerne im Wohnzimmer anschließen würde, sagt der, vergessen Sie’s. Aber man sieht doch hier in der Ecke, dass hier mal ein Ofen stand, sage ich. Ja, aber der Zug ist vielleicht schon weiter oben zugemauert. Und gibt ja keine Pläne mehr, wir können den Zug in Ihrer Wand gar nicht mehr einem der Schlote oben auf dem Dach zuordnen. Das läuft hier alles kreuz und quer. Nix zu machen.
Als ich es Pepe sage, lacht der nur verächtlich und sagt, Dokter, brauchst nich schwitzen, is doch keen Problem. Er kloppt mit ein paar Schlägen seines Lehmanns ein Loch in den Zug meiner Wohnzimmerwand und sagt, ich soll mal meine Hand reinhalten. Dann klettert Pepe aufs Dach des Hauses und schmeißt in jeden der Schlote einen nummerierten Tennisball. Die 4 fällt mir in die Hand. Der Zug ist frei und der Schlot zugeordnet. Selbst der Schornsteinfeger ist beeindruckt, wenn auch widerwillig.
Im Herbst 1998 verschlimmern sich plötzlich Pepes Magenprobleme, und dann erzählt er mir im Galaxy, was er schon lange weiß: „Magenkrebs, Dokter, zu viel Alkohol, Kippen und Lorke. Kannste nix machen. Kismet.“
Es geht schnell. Pepe ist austherapiert und stirbt wenige Wochen später im Lichtenberger Hospiz in der Herzbergstraße.
Zwei Tage vorher besuche ich ihn noch mal. Er hängt an Schläuchen und ist nicht mehr ansprechbar. Wildschwein sitzt an seinem Bett, ebenso seine Tochter. Francis liegt in Pepes schmal gewordenem Arm und leckt die Hand, die sich nicht mehr bewegt.
Nach der Beerdigung hört Wildschwein im Galaxy auf. Eines Tages klingelt sie bei mir und schenkt mir Pepes goldenen Becher. Der ist für dich, hattest ja mal danach gefragt, halt ihn in Ehren. Klaro, sage ich.
Als ich die Scherben einfege, fragt sie mich, was ich für ein Typ bin, der bei einer kaputten Tasse anfängt zu weinen. Ich kippe die Scherben in den Müll und antworte, dass ein verstorbener Freund sie mir vermacht hat. Oh, sagt sie erschrocken, tut mir leid. Und ich antworte: „Allet jut, brauchst nich schwitzen.“
- ISBN: 978-3-86222-478-4